
Staatliche Kunsthalle
Baden-Baden
Gutes böses Geld.
Eine Bildgeschichte der Ökonomie
PK 3.3.2016 | 11 Uhr
Große Landesausstellung 2016
Ausstellung: 5.3. – 19.6.2016
Lichtentaler Allee 8 a
76530 Baden-Baden
http://www.kunsthalle-baden-baden.de/kunsthalle/

Alicija Kwade, Kohle (Union 666), bronze und Reingold 24 karat,
Edition 3, 77 Teile, je 5×6,8 x 17,3 cm, SØR Rusche Sammlung Oelde/Berlin
Künstler:
Dietisalvi di Speme, Lucas Cranach d. Ä., Dosso Dossi, Marinus van Reymerswaele, Bartholomaeus Bruyn d. Ä., Jan Wierix, Lucas van Valckenborch, Georg Flegel, Bartholomeus van Bassen, Pieter de Neyn, Theodoor Rombouts, Adriaen van Utrecht, Pieter Codde, Pietro della Vecchia, David Teniers d. J., Abraham Diepraem, Peeter van Bredael, Pieter van Anraedt, Giovanni Carlone, Johann Heiss, Edwaert Collier, Jan Verkolje, Cornelis Norbertus Gijsbrechts, Johann Peter Hasenclever, Karl Wilhelm Hübner, Ludwig Knaus, Otto Edmund Günther, Ernst Henseler, Hans Richter, Joseph Beuys, Andy Warhol, Yves Klein, Timm Ulrichs, Hanne Darboven, Maria Eichhorn, Cildo Meireles, Sylvie Fleury, Aernout Mik, Christin Lahr, Pratchaya Phinthong, Zachary Formwalt, Adriana Arroyo, Ioë Bsaffot

Anahita Razmi, Iranian Beauty, 2013, Videoloop + gerahmter Din A4 Ausdruck, Courtesy Anahita Razmi, Carbon 12 Gallery
Geld ist nicht ahistorisch – so lautet die grundlegende These der Großen Landesausstellung „Gutes böses Geld“. Im Frühjahr 2016 präsentiert die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden in Kooperation mit dem Casino Baden-Baden, dem Stadtmuseum Baden-Baden und dem Theater Baden-Baden eine 750 Jahre überblickende Bildgeschichte des Geldes. Hier wird gezeigt, wie Künstler Geld und den Umgang damit im Laufe der Jahrhunderte ins Bild gesetzt haben – ausgehend von einer frühen italienischen Darstellung aus Siena von 1286, über Fotografien aus dem New York der 1890er Jahre und endend mit zeitgenössischen Kunstwerken, die kurz vor oder während der jüngsten Finanzkrise entstanden sind.

Sylvie Fleury, ‘Ela 75K, Plumpity… Plump’, 2000, mixed media, 83 x 55 x 96 cm, Courtesy Sylvie Fleury, Mehdi Chouakri
Im Gegensatz zu der klassischen Lehrmeinung der ökonomischen Theorie, die einen über die Jahrhunderte gleichbleibenden Homo Oeconomicus postuliert, scheint die Bildgeschichte des Geldes etwas anderes zu lehren: es steht zu vermuten, dass sich diese Figur immer wieder neu erfunden hat.
Tatsächlich unterliegt die Darstellung von Geld einem beachtlichen Wandel. Im einen Jahrhundert dominieren beispielsweise die positiven und emanzipatorischen Effekte. So führte etwa der soziale Aufstieg von Handelsleuten zu wichtigen Personen des öffentlichen Lebens in den Niederlanden und in Süddeutschland dazu, dass sich diese mit den Insignien ihres neuen Reichtums zeigen durften. Im nächsten Jahrhundert jedoch kam eine neue Bildgattung auf: jetzt wurden Geldstücke in Verbindung mit Totenschädeln dargestellt und zu Vanitasbildern und moralischen Allegorien zusammengeführt.

Anahita Razmi, I´ve got it all (too), 2008, C-Print, 40 x 55 cm, Courtesy Anahita Razmi, Carbon 12 Gallery
Ein sehr konkretes Beispiel für den Wandel sozialer und gesellschaftlicher Normen zeigen zudem die unterschiedlichen Darstellungen von Armut. Für die niederländischen Genremaler des 17. Jahrhunderts ist sie ein quasi naturgegebener Zustand. Zwei Jahrhunderte später hat sich Armut dann zu einer politischen Klassenfrage gewandelt. So sind die Darstellungen der Düsseldorfer Malerschule deutlich von den Schriften Karl Marx’ im 19. Jahrhundert inspiriert.

Dorothea Lange, Migrant mother, 1936, Negativ Nitrat, 10 x 12,7 cm
Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein gibt es fast keine Darstellungen, die Geld als solches thematisieren. Als alleiniges Bildsujet existiert das Zahlungsmittel kaum. Mit Andy Warhols großformatigen seriellen Darstellungen von Dollarscheinen ändert sich dies um 1962 schlagartig. Plötzlich ist allein das Zeigen von Geldscheinen als Gegenstand für sich ohne jeden gesellschaftlichen oder moralischen Kontext möglich. Das markiert in der langen Bildgeschichte des Geldes ein absolutes Novum.
Der Schlusspunkt des Ausstellungsparcours hat die Finanzkrise im Jahr 2008 im Visier. Exemplarisch für die Geldschwemme, die auch die Preise für Kunst in ungeahnte Höhen trieb, steht ein Werk von Alicija Kwade. Für “Kohle (Rekord)” hat die Künstlerin ein herkömmliches Kohlebrikett mit Blattgold umhüllt. Ein zentrales Bild für die Leichtfertigkeit, mit der Werte in den Jahren vor dem Platzen der Blase geschaffen und kurz darauf wieder verbrannt wurden.

Marinus van Reymerswaele, Die Steuereintreiber, ca. 1590, Öl auf Holz, 100 x 76 cm, Museum Stibbert Florenz
Während Alicija Kwades Werk – neben anderen – in den imposanten historischen Räumen des Casino Baden-Baden gezeigt wird, ergänzt das Stadtmuseum Baden-Baden den Ausstellungs-Parcours durch einen speziellen Fokus auf das Brettspiel Monopoly, ergänzt um Fotografien aus den 1900er bis 1940er Jahren. Dass dieses ursprünglich als pädagogisches Instrument konzipiert wurde, um vor den Gefahren von Monopolen zu warnen, ist heute in sein Gegenteil verkehrt. Parallel zur Ausstellung zeigt das Theater Baden-Baden „Wirtschaftskomödie“ von Elfriede Jelinek (Premiere: 26.2.2016). Der Text ist eine Fortschreibung ihres Stücks „Kontrakte des Kaufmanns“, das in der großen Finanzkrise 2008 zum Stück der Stunde wurde. Atemlos, scharfsichtig, pointiert: Die Nobelpreisträgerin prangert darin die hemmungslose Gier des heutigen Finanzkapitalismus an.
https://www.facebook.com/groups/49309405740/



















 but do not shake. Shhhhhh! Can you hear the ticking, or is the sound only circulating my own mind? Aimlessly placed bodies and their equally amputated parts can go numb in the long run. Knock knock! Who’s there? Any. Any who? Any time soon. In the unevenness of time, to the person it concerns his absence depends on the urgency of his business, not the advancements of your own pressing body. You might seem to have all the time in the world, but the world sure doesn’t. Listen; speaking of timezones, what one single item would you take to a remote island? Take your time before you answer, you can always leave a message on my phone later. Stranded, you will start to hate islands and all that they stand for. Waves washing the sand, redundant clocks running out of battery, rounded coconuts, and the deceiving milkiness of coconut water.
but do not shake. Shhhhhh! Can you hear the ticking, or is the sound only circulating my own mind? Aimlessly placed bodies and their equally amputated parts can go numb in the long run. Knock knock! Who’s there? Any. Any who? Any time soon. In the unevenness of time, to the person it concerns his absence depends on the urgency of his business, not the advancements of your own pressing body. You might seem to have all the time in the world, but the world sure doesn’t. Listen; speaking of timezones, what one single item would you take to a remote island? Take your time before you answer, you can always leave a message on my phone later. Stranded, you will start to hate islands and all that they stand for. Waves washing the sand, redundant clocks running out of battery, rounded coconuts, and the deceiving milkiness of coconut water. After all, it’s not milk, but water. Water washes waves with water, not milk. Meanwhile, can I charge my phone in your wall, I’m expecting an important call, from somebody, important. Ring ring! Who’s there? Some. Some who? Some body, important. A pressing body presses itself against another but only one of them seems to give in. As one body fails and falls to the ground, the other walks away, leaving behind nothing but footprints in the sand that could belong to anybody who owns a pair of feet. Waves washes away waves with water, wasser and well, alone, you remain, stranded, with your favourite item. You write a note from right to left and place it on top of the other: Be right back. Tick Tock! Who’s there? Not. Not who? Not anybody that you know. You sit down in silence, on an island, killing time, as if time had a body to break down. Stranded islands always seem so remote, and even more so in winter. In the absence of anything happening, all you recall is the story of an old nordic esoteric eccentric who died alone on a remote island after following a pure coconut diet. Day in and day out, he drank nothing but this milk-impersonating water.
After all, it’s not milk, but water. Water washes waves with water, not milk. Meanwhile, can I charge my phone in your wall, I’m expecting an important call, from somebody, important. Ring ring! Who’s there? Some. Some who? Some body, important. A pressing body presses itself against another but only one of them seems to give in. As one body fails and falls to the ground, the other walks away, leaving behind nothing but footprints in the sand that could belong to anybody who owns a pair of feet. Waves washes away waves with water, wasser and well, alone, you remain, stranded, with your favourite item. You write a note from right to left and place it on top of the other: Be right back. Tick Tock! Who’s there? Not. Not who? Not anybody that you know. You sit down in silence, on an island, killing time, as if time had a body to break down. Stranded islands always seem so remote, and even more so in winter. In the absence of anything happening, all you recall is the story of an old nordic esoteric eccentric who died alone on a remote island after following a pure coconut diet. Day in and day out, he drank nothing but this milk-impersonating water. Watching waves washing, water washing water, Wer weiß wann. When they then found him numb and lifeless they were unsure if it was the fatal fall of a coconut or his faddy diet that in the end killed him. Either way, it was an end. Speaking of, time is up. So, what is your favourite item, the one you would take to a remote island? The item of your choice is time, not because it rhymes, but because it seems as if you have all the time in the world, even though the world itself doesn’t. Shhhhhh! I can no longer hear the ticking, unless you tell me that it’s touching you too.
Watching waves washing, water washing water, Wer weiß wann. When they then found him numb and lifeless they were unsure if it was the fatal fall of a coconut or his faddy diet that in the end killed him. Either way, it was an end. Speaking of, time is up. So, what is your favourite item, the one you would take to a remote island? The item of your choice is time, not because it rhymes, but because it seems as if you have all the time in the world, even though the world itself doesn’t. Shhhhhh! I can no longer hear the ticking, unless you tell me that it’s touching you too.




 Nocturnal Banquet (788 KB)Wolfgang Heimbach (Ovelgönne/Oldenburg c. 1613 – after 1678?) 1640 dated copper, 62 x 114 cm Picture Gallery © KHM-Museumsverband
Nocturnal Banquet (788 KB)Wolfgang Heimbach (Ovelgönne/Oldenburg c. 1613 – after 1678?) 1640 dated copper, 62 x 114 cm Picture Gallery © KHM-Museumsverband



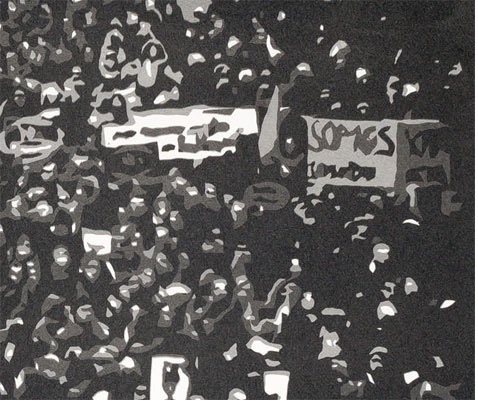
















You must be logged in to post a comment.